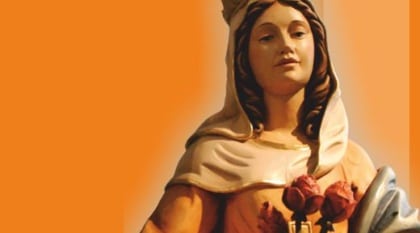Wer kennt heute den heiligen Bonaventura? Sicher franziskanische Ordensleute, selten Theologinnen und Theologen und noch seltener Menschen, die einen geistlichen Weg suchen und eines seiner Werke zu lesen beginnen. Sein persönlicher Weg zeigt uns jedoch, wie Gottsuche in eine tiefer überlegte Sehnsucht hineinzuführen vermag. Doch wie ist das möglich? Bonaventura wird als „Fürst unter den Mystikern“ (Papst Leo XIII.) bezeichnet, und sein äußerer und innerer Weg ist eindrücklich. Kernbegriff seiner geistlichen Sichtweise ist die „Feuersglut himmlischer Sehnsucht“. Sie steht wie eine geistliche Vision über allem und vermag dieses Feuer ins Zentrum seines Lebens zu stellen.
Geboren wird Johannes Fidanza (Ordensname: Bonaventura) 1217 oder 1221 in Bagnoreggio bei Orvieto. Die etruskische „Cività“ ist als Städtchen auf dem Hügel bis heute faszinierend. Ein Ort mitten in allem und letztlich über allem stehend. Er beginnt 1235 seine Studien in Paris und tritt 1243 in den Franziskanerorden ein. Nach den Grundstudien studiert er Theologie und wird 1253/54 Magister (Professor) der Theologie. Am Pariser Ordensstudium lehrt er Theologie. Am 2. Februar 1257 wird er zum Generalminister und Leiter des Minderbrüderordens in allen Ländern gewählt. Nun ist er dauernd von einer Gemeinschaft zur anderen und von einem Problemfeld zum anderen zu Fuß auf den Straßen Europas unterwegs.
Krise auf dem Berg La Verna
All das führt ihn selber in eine tiefe Krise hinein. Wie lebt ein Franziskaner? Auf welche Art soll der Orden organisiert werden? Was wollte Franziskus wirklich? Welche Dienste sollen Ordensbrüder tun? Im Herbst 1259 zieht er sich auf den Berg La Verna zurück, um in der Einsamkeit Antworten auf diese Fragen zu finden und um sich selber wieder zu finden. Eine Kapelle zeigt bis heute den Ort des Gebetes Bonaventuras in einem sehr kleinen Raum mitten in den Felsen. Sie ist nicht weit entfernt vom heute bezeichneten Stigmatisierungsort des Franziskus.
Intensiv setzt sich Bonaventura mit der stillen Zeit des Franziskus auf dem Berg La Verna auseinander. Dabei entdeckt er das Geheimnis der Kontemplation, also eines intensiven Lebens aus dem ihn selbst wandelnden Gebet. Auf dem Berg La Verna entsteht der „Pilgerweg der Seele zu Gott“, der den Weg des Menschen schlechthin darzustellen versucht. Der Seraph, dem Franziskus begegnet, ist nach Bonaventura die Gegenwart des dreieinen Gottes, dessen uns berührende Seite Jesus Christus ist. Je zwei Flügel der sechs Flügel kommen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu. Franziskus begegnet dem dreieinen Gott und wird durch ihn verwandelt. Bonaventuras Theologie und Spiritualität drehen sich vor allem um den dreieinen Gott und finden in ihm Halt und Mitte.
Bonaventura formuliert die franziskanische Spiritualität
Bonaventura beginnt, Brüder, aber auch andere Menschen über Franziskus und menschliche Erlebnisse mit ihm zu befragen. Daraus entstehen nach verschiedenen schon vorhandenen Berichten seine „Große und Kleine Franziskuslegende“, die eine theologisch fundierte Darstellung der Spiritualität des Franziskus sind. Neben dem geschichtlichen Lebenslauf formuliert Bonaventura auch die Spiritualität des Franziskus intensiv aus und stellt sie in die Mitte seines Berichtes. Das eigentliche Geheimnis ist für ihn seine intensive Beziehung zu Jesus Christus. Der Poverello sucht die Spuren Jesu, geht ihnen nach und versucht sie im eigenen Alltag umzusetzen. Die Armut macht ihn Jesus ähnlich. Die Liebe zu den Geschöpfen, zu den Lerchen, zu Bruder Falke und Schwester Lamm, lässt ihn den Schöpfer in den Kleinigkeiten des Alltags erleben.
Die menschlichen Sinne erfahren eine neue Beachtung und führen zu einer Vertiefung der geistlichen Sinne. Franziskus schaut Gott nicht nur an, sondern wird von Gott angeschaut und lebt im Blick Gottes. Diese erste Erfahrung vor dem Kreuz von San Damiano wird zu einer immer neuen Erfahrung in seinem Leben. Es ist die Erfahrung der Wandlung, die Gott schenkt. Geistliches Leben ist dauerndes Hineingenommen-Werden in ein Verwandelt-Werden. Nicht ich wandle, sondern ich werde verwandelt. Bonaventura vermittelt ein gewandeltes Bild des Armen aus Assisi, in dem die Menschen die Gegenwart Jesu erleben können. Diese Spiritualität versucht er seinem Orden und vielen Menschen zu vermitteln. So kommuniziert er franziskanische Spiritualität in die kommende Geschichte der Kirche hinein.
Ein Dienst an der Kirche
Bonaventuras Einfluss auf den Orden und auf die Kirche wird durch seine Arbeit immer wichtiger. Dies führt schließlich dazu, dass ihn Papst zum Kardinalbischof von Albano ernennt. Geistlich eindrücklich ist die (späte) Erzählung, dass Bonaventura im Kloster von Mugello in der Nähe von Florenz auch als Generalminister gerade beim Abwaschen des Geschirrs gewesen sei, als der päpstliche Legat kam, um ihm den Kardinalshut zu bringen. Er sagt ihm: „Lass mich zuerst den Abwasch fertig machen“. Er tut, was er gerade tut, aus ganzem Herzen, und das ist wichtiger als alles andere, was er dann auch noch tun könnte und nun sogar tun sollte. Eine faszinierende Erzählung angesichts der bis heute bestehenden Versuchung, wegen kirchlicher Ämter stolz und überheblich zu werden. So wird Bonaventura am 12. November 1273 in Lyon durch den Papst zum (Kardinal-) Bischof von Albano geweiht.
Er erhält von Papst Gregor X., der vermutlich ein Schüler Bonaventuras war, den Auftrag, im Konzil von Lyon die Ost- und die Westkirche wieder zu einer Einheit zusammenzuführen. Durch Franziskanerbrüder, die er in den Osten sendet, etwa einen aus Griechenland stammenden Franziskaner, der die griechische Landessprache als Muttersprache beherrschte, bekommt er schnell Kontakt mit den Bischöfen und dem griechischen Patriarchen des Ostens. Und auch mit den politisch Mächtigen, vor allem dem Kaiser des byzantinischen Reiches, die einen sehr großen Einfluss auf kirchliche Fragen haben. Auch Papst Gregor X. nutzt die direkten Kontakte der römischen Kurie in den Osten. So erbittet er 1273 von Vertretern in der ganzen Christenheit ihre Meinung, ob eine Vereinigung der beiden Kirchen wichtig, machbar und notwendig sei. Können Ostrom (Konstantinopel) und Westrom (Rom) im christlichen Glauben wieder zusammenfinden? Oder bleiben sie zwei getrennte Welten, die einander nicht verstehen und zu misstrauen drohen?
Die Vereinigung der östlichen und der westlichen Kirche
Auf dem 2. Konzil von Lyon, das im März 1272 einberufen wurde und von Mai bis Juli 1274 stattfindet, gelingt der Kirche und besonders dem damit beauftragten Bonaventura das Unfassbare: Die seit 1054 getrennten Kirchen finden wieder zur Einheit zurück. Wegen Sturm und Schiffbruch konnte die griechische Delegation erst am 24. Juni in Lyon eintreffen. So wurde zum Hochfest der heiligen Petrus und Paulus, den Patronen der päpstlichen westlichen Kirche, am 29. Juni 1274 unter dem Vorsitz des Papstes gemeinsam Eucharistie gefeiert. Auf diese Weise wurden die beiden Kirchen in der Feier miteinander vereinigt. Bonaventura hielt die Festpredigt.
Die Westkirche bekannte auf Lateinisch ihren Glauben, die Ostkirche auf Griechisch. Beide Seiten bekannten das umstrittene „Filioque“, dass der Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht und nicht nur vom Vater. Hier wurde dieses „Filioque“ auch von der griechischen Kirche bekannt. Aber sie erhielt gleichzeitig die Erlaubnis, es in ihrem Glaubensbekenntnis künftig nicht formulieren zu müssen. Das ist ein eindrücklicher Kompromiss des Konzils, der zwar auf der Richtigkeit einer Aussage beharrt, aber gleichzeitig auch bekennt, dass die frühere Fassung des Glaubensbekenntnisses ebenso gebetet werden darf und ebenfalls gültig ist.
Am 6. Juli wurde die kirchliche Einheit nochmals gefeiert, indem die griechische Kirche den Primat, die Vorrangstellung des Papstes, ausdrücklich anerkannte und sich diesem unterstellte. Gleichzeitig erhält sie die Erlaubnis, ihre unterschiedliche östliche Liturgie weiterhin feiern zu können. Leider zerbrach die Einheit der Kirche aber in kurzer Zeit wieder – wegen politischer Spannungen und Machtausübung im Osten und der Unklugheit der folgenden Päpste im Westen, die den Kaiser von Byzanz zweimal exkommunizierten. Spätestens 1282, als Kaiser Michael von Byzanz starb, brach die Einheit ganz auseinander. Damit gab waren es wieder zwei konkurrierende Kirchen im Osten und im Westen.
Bonaventuras Tod am 15. Juli 1274
Noch auf dem Höhepunkt der Feiern der kirchlichen Einheit brach Bonaventura zusammen und starb unerwartet am 15. Juli. Es ist nachvollziehbar, dass diese geistliche, theologische und kirchliche Größe keine Lebenskraft mehr in sich hatte. Jahrelang leitete er unter schwierigsten Bedingungen den zerstrittenen und angefochtenen Franziskanerorden weltweit bis in den Frühling 1274, bereitete den Kontakt und die Verhandlungen mit Ostrom vor, gewann das Ja von Konstantinopel und war wesentlich an der Leitung der Vereinigungsverhandlungen und -feiern beteiligt. Am folgenden Tag wurde er vom ganzen Konzil unter Leitung des Papstes in Lyon beerdigt. Für die Kirche war dieses Jahr 1274 ein Wendepunkt. Es mussten wieder ganz neue Wege aus dem Glauben gesucht werden.
Durch seine eigene intensive Suche nach der Spiritualität des Franziskus gelingt es Bonaventura, dem Feuer des Gebetes und der Kontemplation neue Kraft zu geben und die schon von anderen beschriebene franziskanische Spiritualität in neuer Tiefe zu formulieren. Franziskus wird als schwacher Mensch zum prophetischen Bild eines durch die Kraft der Gottesbeziehung verwandelten Menschen. Sein Leben mit Jesus Christus wird zum Zentrum seines Daseins. Es wird in seinem persönlichen geistlichen Leben, in seinen Diensten an den Armen, in seiner missionarischen Kraft und in der Begegnung mit dem muslimischen Sultan von Ägypten deutlich, dass die franziskanische Spiritualität für viele Menschen weltweit und für die Kirche als Ganze wichtig ist.
Bonaventura heute
Auch heute muss die Tiefe einer intensiven Gottsuche, nach Jesus Christus, im Zentrum unseres geistlichen Lebens stehen, damit wir immer neu lebendig werden können. Sie muss sich immer aber auch auf andere Menschen hin öffnen, auch auf solche, die den christlichen Glauben nicht teilen oder am Rande der Gesellschaft stehen. Die Tiefe des Gebetes eröffnet den Mut, auch in den fruchtbaren Dialog mit Fremden treten zu können. Die innere Tiefe schenkt Halt in jeder Begegnung.
Ebenso ist Bonaventuras Sehnsucht nach der Einheit der Kirche eine wesentliche Leidenschaft, die er bis heute weitergibt. Ost- und Westkirche sind immer noch getrennt, die Reformation zerriss im 16. Jahrhundert die Kirche erneut, und heute gibt es verschiedene Freikirchen und schwere interne Spannungen auch in der katholischen Kirche sind belastend und trennend. Den Wert anderer christlicher Auffassungen zu entdecken, gemeinsamen Einsatz für die Armen und für den Frieden in die Mitte zu stellen und von Christinnen und Christen lernen zu dürfen, sind auch heute wesentliche Elemente des christlichen Glaubens.