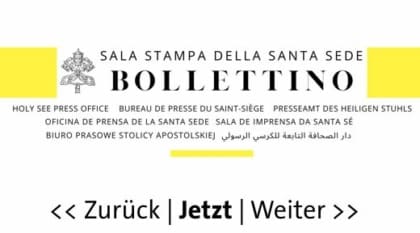Das Pontifikat beginnt mit einem Coup. Als der Argentinier Jorge Mario Bergoglio am Abend des 13. März 2013 auf die Loggia des Petersdoms tritt, überrascht er gleich mit einem Triple. Das hatte es noch nie gegeben: Zum ersten Mal ein Papst aus Lateinamerika. Zum ersten Mal ein Jesuit auf dem Heiligen Stuhl. Und zum ersten Mal gibt sich ein Pontifex diesen Namen: Franziskus. Die Namenswahl ist mehr als ein neckischer Einfall. Der Name ist Programm. Mit Blick auf den Heiligen von Assisi wird der durch und durch ignatianisch geprägte Bischof von Rom während seiner zwölfjährigen Amtszeit entscheidende Impulse für die weltweite Kirche setzen. Stichworte genügen.
„Vergiss die Armen nicht!“
„Vergiss die Armen nicht!“ – dies hatte der brasilianische Kardinal Cláudio Hummes, selbst Franziskaner, dem gerade eben gewählten Papst noch im Konklave mit auf den Weg gegeben. Tatsächlich ist das dann ein durchgehendes Thema des Bergoglio-Pontifikats: eine arme Kirche für die Armen. Die einfache Formel hat klar zwei Stoßrichtungen. Es geht einmal um den eigenen Lebensstil, und da setzt Franziskus schnell deutliche Akzente: Statt im Apostolischen Palast wohnt er im Gästehaus Santa Marta. Er tritt bescheiden und einfach auf. Er verabscheut jede Form von Klerikalismus und fordert noch vom Krankenbett in der Gemelli-Klinik eine Liturgie ohne „Prunk und Protz“. Wiederholt geißelt er Karrieremacherei, Arroganz und eine „Pathologie der Macht“ in kirchlichen Kreisen. Christen sollen sich nicht im Zentrum tummeln, sondern an die Ränder gehen. Der Rand ist der Platz der Kirche. Und damit rückt er die Armen selbst in den Blick.
Demonstrativ nimmt Papst Franziskus auf seinen Reisen die Mahlzeiten nicht nur mit den Großen aus Gesellschaft und Politik ein, sondern isst gemeinsam mit Armen und Obdachlosen. Am Gründonnerstag wäscht er nicht zwölf Priestern die Füße, sondern geht im Gefängnis vor verurteilten Straftätern in die Knie, darunter auch Muslimen und Buddhisten. Gleich auf seiner ersten Reise hatte er auf der „Flüchtlingsinsel“ Lampedusa an die Tausenden im Mittelmeer ertrinkenden Migranten erinnert und eine Globalisierung der Gleichgültigkeit kritisiert. Sicher, das alles sind nur Zeichen. Aber sprechende, provozierende, prophetische Zeichen. Und damit es nicht bei päpstlichen Zeichen bleibt, führt er 2016 einen „Welttag der Armen“ ein, der das Engagement für die Menschen am Rand in alle Ecken der Kirche tragen soll.
Die Umweltenzyklika Laudato si
Mit seiner Umweltenzyklika Laudato si von 2015 – auch das ein Novum in der Kirchengeschichte! – legt Papst Franziskus seinen Finger in eine andere große Wunde unserer Zeit. Dabei entleiht er nicht nur den Titel dem Sonnengesang, sondern beruft sich auch in seiner leidenschaftlichen Sorge um das gemeinsame Haus wiederholt explizit auf seinen Namensvetter aus Assisi. Bis in den Titel franziskanisch inspiriert ist auch seine zweite große Enzyklika Fratelli tutti „über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft“, die er 2020 symbolträchtig in Assisi am Grab seines Namenspatrons unterschreibt. Schon im Jahr zuvor, genau 800 Jahre nach der Begegnung von Franz von Assisi mit dem Sultan Al-Malik al-Kamil, hatten der Papst und Ahmad al-Tayyib, das Oberhaupt der Azhar, in Abu Dhabi einen gemeinsamen Text über die Geschwisterlichkeit aller Menschen unterzeichnet.
„Franziskus, bau mein Haus wieder auf, das ganz zerfällt!“ Seitdem Franz von Assisi vor dem Kreuz von San Damiano diesen Ruf Christi gehört hat, ist der Einsatz für die Erneuerung der Kirche ein wesentlicher Baustein der franziskanischen DNA. Wird der Franziskus aus Rom als Reformpapst in die Geschichte eingehen? Das Anliegen selbst hat ihn zweifelsohne mächtig umgetrieben: Er hat eine Reform der Kurie in Gang gesetzt. Er hat wichtige Positionen im Vatikan, die bisher Klerikern vorbehalten waren, mit Frauen und Laien besetzt. Sein nachsynodales Schreiben Amoris laetitia und andere Verlautbarungen ermutigen die Seelsorger, in der kulturell so vielfältigen Weltkirche stärker auf die konkrete Situation der Menschen einzugehen.
Papst Franziskus und der synodale Prozess
Nicht zuletzt hat er in der gesamten Kirche einen von der Basis getragenen synodalen Prozess angestoßen. Da ist in – für kirchliche Verhältnisse – relativ kurzer Zeit unglaublich viel in Bewegung gekommen. Die Anliegen des Synodalen Wegs in Deutschland allerdings hat er nicht immer geteilt und manchmal vielleicht auch nicht richtig verstanden. Dennoch, insgesamt ist mit diesem Papst ein neuer Stil in die Kirche eingezogen, in das innerkirchliche Ringen ebenso wie in das Gespräch der Kirche mit der Welt und den anderen Religionen. Und Stilfragen sind wichtig. Wo sich äußerlich der Stil verändert, ist auch innerlich vieles anders geworden.
Franz von Assisi wollte nichts anderes, als das Evangelium leben. Die Faszination der frohen Botschaft hat ihn zu radikalen Entscheidungen und leidenschaftlichem Engagement gedrängt. Diese Verbindung von Mystik, Evangelisierung und Politik zeichnet gleich das erste Apostolische Schreiben Evangelii Gaudium des Bergoglio-Papstes aus und kennzeichnet dann sein gesamtes Pontifikat: Die Freude am Evangelium führt die Kirche zu einem neuen missionarischen Aufbruch, zu den Armen und zur prophetischen Kritik eines Wirtschaftssystems, das „tötet“. Freunde hat sich der argentinische Papst mit solchen Aussagen nicht immer gemacht. Man hat über ihn auch den Kopf geschüttelt und er ist auf Widerstand gestoßen. Aber auch den heiligen Franziskus hielten anfangs viele für einen Narren. Und Jesus selbst wurde von seinen Verwandten für verrückt erklärt. Da befand sich der Jesuit auf dem Papstthron in guter Gesellschaft Jesu.